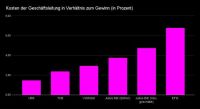Boris Collardi wird nächstes Jahr erst 50 Jahre alt, aber schon heute ist er eine Legende des Schweizer Bankwesens. Kaum jemand hat in jungen Jahren so viel erlebt wie der gebürtige Westschweizer, der mit 34 Jahren CEO der Bank Julius Bär wurde. Er sei eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Schweizer Banking und vielleicht einer der am besten vernetzten Männer in der Finanzwelt, schrieb die Financial Times in einem Interview-Porträt am Wochenende.
Seine fast zehnjährige Führungstätigkeit bei Julius Bär sieht er heute kritisch. Die verwalteten Vermögen stiegen von 159 auf 388 Milliarden Franken. 2008 beschäftigte die Bank 619 Kundenberaterinnen und -berater, 2017 waren es 1396. Dieses explosive Wachstum habe eine Kehrseite, sagt Collardi. «Wenn man zurückhaltend ist, wenn man diskret ist, wenn man ruhig ist, dann ist das sicher in vielen Lebensbereichen sehr hilfreich. Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn man sich zu sehr in den Vordergrund drängt oder zu ehrgeizig ist», sagt Collardi.
Bescheidenheit und Demut sind keine Eigenschaften, die man mit Collardi verbindet. Eher das Gegenteil. «Ich finde das Bild, dass man sagt: 'Oh, Boris war ein Geschäftsmann, aber er hat nicht so genau hingeschaut, nicht sehr fair, denn es gab Probleme vor mir, es gab Probleme während meiner Zeit und es gab Probleme nach mir'», sagt Collardi.
Ein paar Gauner
Nach den Finanzskandalen um den venezolanischen Ölkonzern PDVSA und den Weltfussballverband Fifa führte die Finma ein Enforcementverfahren gegen Julius Bär. Es endete mit einer scharfen Rüge. Die Behörde stellte gravierende Mängel in der Geldwäschereibekämpfung für den Zeitraum 2009 bis 2018 fest.
Das vernichtende Verdikt schadete Collardi massiv, der kurz darauf als Partner bei Pictet zurücktrat. Über die Hintergründe äussert er sich nicht. Es habe kulturell nicht gepasst, sagt er. Heute ist Collardi Investor und Verwaltungsrat bei EFG International.Im Private Banking gebe es keine Patentrezepte, sagt er im Rückblick. «Haben wir unsere Probleme selbst gemacht? Auf jeden Fall, ja ... Wir hatten ein paar Banker, die Gauner waren, und ein paar Kunden, die Gauner waren. War das systematisch? Nein.»
Er wolle sich gar nicht exkulpieren. Er sei der Chef gewesen. Die Verantwortung habe bei ihm gelegen. Aber er habe daraus gelernt und sich weiterentwickelt. «Ich verkörpere nicht die Probleme des Schweizer Bankwesens», sagt er. Ein halbes Jahr nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse habe er das «Gefühl, dass die Marke Schweiz in der Defensive ist».
Unangenehme Situation
Die Rolle der Schweiz sieht Collardi kritisch. Das Land befinde sich in einer «unangenehmen Situation». Die Eidgenossenschaft habe sich den EU-Sanktionen gegen Russland angeschlossen, betrachte sich aber als neutral. «Vor allem asiatische Kunden von Schweizer Banken fragen sich nun, ob diese Neutralität überhaupt etwas bedeutet», sagt er. «Die Leute sind überrascht. Sogar schockiert. Die Leute, mit denen ich in Asien spreche, fragen alle: 'OK, können wir der Schweiz jetzt noch vertrauen?
Das Bankwesen in der Schweiz hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Schweiz ist längst nicht mehr der Hort von Schwarzgeld, für den sie immer noch gehalten wird. Dieser Wandel wird noch nicht überall wahrgenommen. Alte Stereotypen bräuchten Zeit, um abzusterben, sagt Collardi.
Problematische Gelder hätten die Schweiz verlassen. Jeder mit etwas Erfahrung wisse, dass «das ganze schmutzige Geld nach Dubai und in andere Länder des Nahen Ostens geflossen ist».