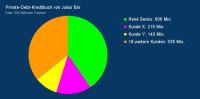Julius Bär gilt mit einem Kundenvermögen von 440 Milliarden Franken als grösste Schweizer Privatbank. Eine Privatbank im engeren Sinne ist sie aber schon lange nicht mehr. Im Jahr 1980 ging sie an die Börse. Bis 2005 behielt die Familie Bär über Stimmrechtsaktien die Kontrolle über die Gruppe. Dies änderte sich 2005 mit der Einführung des Prinzips «one share - one vote». Der Anteil der Familie Bär fiel unter die Meldeschwelle von 3 Prozent.
Seither wird das Aktionariat von Vermögensverwaltungsgesellschaften dominiert. Grösster Aktionär ist aktuell der US-Fondsmanager MFS Investment Management. Dieser hat in den letzten 14 Tagen rund 200 Millionen auf seiner Bär-Position verloren. Dahinter folgen weitere Vermögensverwalter wie Blackrock, UBS Funds Management und T. Rowe Price, die je rund fünf Prozent halten und damit je 50 Millionen Franken verloren haben – respektive die Fondsbesitzer. Zusammen sind das 350 Millionen Franken, die allein die vier grössten Aktionäre als Buchverlust hinnehmen mussten.
Other People's Money
Es ist nicht zu erwarten, dass die Aktionäre Druck auf das Management und den Verwaltungsrat ausüben werden. Der Fall Credit Suisse hat gezeigt, dass ein zersplittertes Aktionariat selbst die grössten Managementfehler ohne grosses Murren hinnimmt. Für den Verwaltungsratspräsidenten Romeo Lacher und den CEO Philipp Rickerbacher bedeutet diese Konstellation, dass sie wohl in ihren Ämtern bleiben werden. Ausser sie nehmen sich selber aus dem Rennen.
Anders sähe es bei Banken aus, die einen starken Aktionär im Hintergrund haben. Dort hätte es längst Rücktritte gegeben. Es ist auch kaum vorstellbar, dass eine klassische Privatbank wie Lombard Odier oder Pictet einem einzelnen Kunden einen so grossen Kredit gewährt hätte wie Julius Bär an Benko. Keinem der Partner wäre es in den Sinn gekommen, das eigene Geld so leichtfertig aufs Spiel zu setzen.