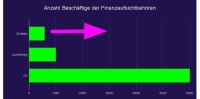«Sergio Ermotti hat den schwierigsten Job der Bankenindustrie weltweit»
Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher lobte Sergio Ermotti und sein Millionengehalt: «Er hat den schwierigsten Job in der Bankenindustrie weltweit. Und er liefert!» Ermotti habe es in wenigen Monaten geschafft, die CS zu stabilisieren – «und damit auch den Finanzplatz Schweiz».
Anders sah es ein Kleinaktionär aus dem Tessin, der im Anzug, mit langen Haaren und Stirnband ans Rednerpult trat. Er meinte: «Ich als Schweizer und CS-Investor fühle mich schon etwas beschissen.» Schlussendlich habe die Credit Suisse im März 2023 nur einen Engpass gehabt – deshalb sei es so einfach gewesen, die Lage der Bank danach zu stabilisieren.
Damit meinte der Kleinaktionär, dass die UBS für nur 3 Milliarden Franken eine Bank mit 50 Milliarden Eigenkapital kaufen konnte. Nach Abzug verschiedener Positionen blieben der UBS 35 Milliarden als sogenannter Badwill. Das ist ein dickes Polster, das viel Druck von der Integration der beiden Banken wegnimmt. Ermotti kann sich einige Schnitzer erlauben, ohne dass dies allzu stark ins Gewicht fällt.
Kelleher hat insofern Recht, als es noch nie eine Fusion zweier global systemrelevanter Banken gegeben hat. Es gibt keine Blaupause für diese Mammutfusion. Ob der Zusammenschluss dereinst gelingt, wird sich aber erst in einigen Jahren zeigen. Erst dann weiss man auch, wie gut Ermotti den «schwierigsten Job» gemacht hat.
«Die UBS hat keine ‘implizite Staatsgarantie’».
Sergio Ermotti begründet dies mit einem Vergleich der Finanzierungskosten, die bei der UBS um 2,5 Prozentpunkte höher liegen als beim Bund. Auch die Ratingagenturen würden der Bank keine Staatsgarantie attestieren. «Deshalb sind die Ratings, welche die UBS von den Ratingagenturen erhält, tiefer als jene von Banken mit impliziter oder expliziter Staatsgarantie».
Dass die UBS über eine Staatsgarantie verfügt, hat sie bereits am eigenen Leib erfahren, als sie 2008 vom Staat gerettet wurde. Darüber hinaus gibt es Notfallrettungsmechanismen, über die nur Banken wie die UBS verfügen, die für die Stabilität des Finanzsystems wichtig sind. Mit der sogenannten Emergency Liquidity Assistance (ELA) der Nationalbank kann sich die UBS im Notfall mit Liquidität versorgen. Kleinere Banken haben keinen Zugang zu diesem Instrument. Unternehmen der Realwirtschaft erst recht nicht.
Im Fall der Credit Suisse kamen noch ELA+ und der Public Liquidity Backstop (PLB) hinzu. Bei Letzterem handelt es sich explizit um eine staatliche Liquiditätshilfe, die im Fall der CS per Notrecht eingeführt wurde. Konkret kann die Nationalbank der UBS in einer Notlage eine vom Bund garantierte Sonderliquidität zur Verfügung stellen. Die Grundlagen des PLB sollen nun im Bankengesetz verankert werden.
«Die UBS ist nicht ‘too big to fail’»
Die UBS war 2008 schon too big to fail, als der Staat eingreifen musste und die Bank mit gezielten Massnahmen vor dem Zusammenbruch bewahrte. Später hat der Staat mit Notrecht dafür gesorgt, dass die UBS Kundendaten an die USA ausliefern konnte. Hätte man das nicht getan, wäre die UBS angeklagt worden. Gibt es heute wirklich keine Risiken mehr, die ein Eingreifen Staates erfordern?
Es stimmt, dass in den letzten Jahren viel getan wurde, um grosse Banken abwicklungsfähig zu machen. Die Krise der Credit Suisse hat aber gezeigt, dass dies nur in der Theorie funktioniert. Selbst wenn man jetzt daraus lernt und die Abwicklungsmechanismen verbessert, heisst das noch lange nicht, dass sie in der Praxis auch angewendet werden. Ein Kernproblem bleibt: Wenn die UBS abgewickelt würde, wäre der Finanzplatz Schweiz am Ende – wer würde dann noch Geld in der Schweiz anlegen wollen? Die Reputation der Schweiz wäre nachhaltig zerstört.